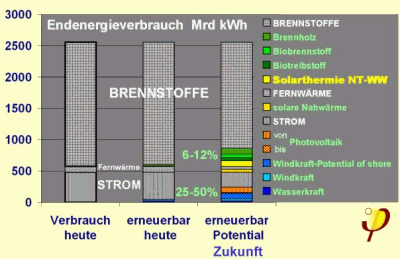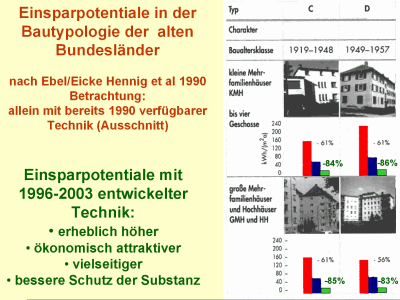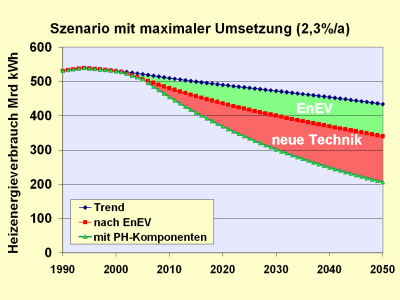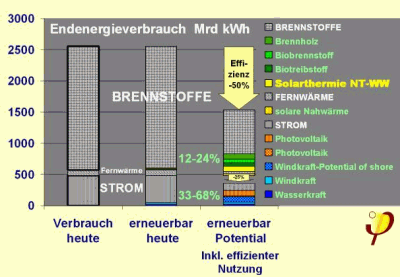|
Umsetzung und Finanzierung
Einordnung in die Energieverbrauchsstruktur
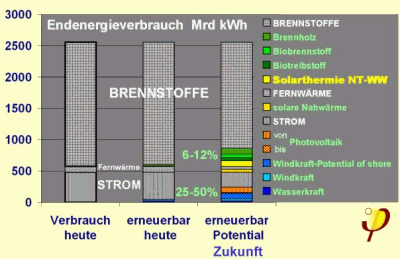
Abb. 1 (Struktur des Endenergieverbrauchs
(2000) in Deutschland, heutige Anteile erneuerbarer Energieträger
und Potentiale für künftige Anteile) zeigt die Aufteilung
des derzeitigen Endenergieverbrauches in Deutschland auf Brenn-
und Treibstoffe, Fernwärme und Strom (alle Sektoren, Quelle [Arge
2001]-Klick aufs Bild für eine bessere Auflösung). Den
weitaus überwiegenden Anteil mit 78% an der Energieversorgung haben
danach die Brenn- und Treibstoffe; Strom folgt mit etwa 18%, die
Fernwärmeverteilung kommt auf 4%. Die jeweiligen Anteile an erneuerbarer
Energie sind im Diagramm zum besseren Kontrast farbig dargestellt.
Heute liegt der Anteil des aus erneuerbaren Energiequellen erzeugten
Stromes immerhin schon um ca. 9%. Dagegen sind die Anteile von erneuerbarer
Energie im Bereich der Substitution von Brennstoffen bisher bescheiden:
Der Einsatz von Brennholz und anderer Biomasse liegt derzeit um
etwa 2%, die thermische Nutzung von Sonnenenergie, vor allem zur
Warmwasserbereitung, noch im Promille-Bereich. Wenn man für die
künftige Nutzung erneuerbarer Energiequellen in diesem Sektor optimistische
Annahmen trifft, ergeben sich erhöhte technisch-wirtschaftliche
Potentiale, die aber mit 6 - 12% nicht annähernd ausreichend
für die Einhaltung der Klimaschutzziele sind; jedenfalls solange,
wie vom heutigen Verbrauchsniveau an Brenn- und Treibstoffen ausgegangen
wird. Hier liegt genau der entscheidende Ansatzpunkt für den Beitrag
der Effizienztechnik. Der Beitrag der erneuerbaren Energiequellen
an der künftigen Versorgung kann ganz erheblich gesteigert werden,
wenn zugleich die Effizienz der Energienutzung verbessert wird.
Energieeffizienzverbesserung im
Bereich Heizung
Bereits auf der 3. Passivhaustagung (ebenfalls in Bregenz im Jahr
1999) wurde die grundsätzliche Vorgehensweise für eine Modernisierung
des Bestandes an Gebäuden mit Hilfe von hocheffizienten Komponenten
dargestellt. Als wichtigster Grundsatz stellte sich dabei „wenn
schon, denn schon“ heraus: Wenn eine entsprechende Komponente
des Gebäudes angepackt wird, dann ist es entscheidend, auch die
energetische Qualität des betroffenen Bauteils auf ein zukunftsfähig
verbessertes Niveau zu bringen. Vgl. auch: Nicht
an der Dämmdicke sparen!
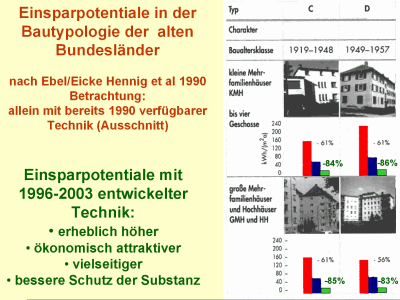
Welche Bedeutung die im letzten Jahrzehnt vor allem durch die
Passiv-haustechnik neu entwickelten Bauteile für das Energieeinsparpo-tential
in bestehenden Gebäuden haben, geht aus Abb. 2 hervor. (Einsparpotentiale
in der Bautypologie der alten Bundesländer (nach [Ebel 2000]), ergänzt
um die Potentiale der inzwischen weiterent-wickelten Technik (grün).
Klick auf das Bild für eine größere Version).
Hierbei wurden die Baualtersklassen 1919-1948 sowie 1949-1957 aus
der Gebäudetypologie der alten Bundesländer herausgegriffen -
dargestellt sind die Mehrfamilienhäuser.
Mit der bis 1990 bereits zur Verfügung stehenden Technik konnte
ein wirtschaftlich vertretbares Energieeinsparpotential (Kosten
der Einsparenergie um 0,065 €/kWh) von um 60% gegenüber dem jeweiligen
IST-Zustand der Gebäude erschlossen werden. Die mit sorgfältig ausgeführten
Maßnahmen erreichbaren Energiekennwerte bei der Modernisierung lagen
zwischen 65 und 90 kWh/(m²a), somit in einem Bereich, der dem Standard
"Niedrigenergiehaus" zuzuordnen war. Die jeweils grünen
Säulen ganz rechts in Abb. 2 zeigen den mit Passivhaus-Technik
heutigen Standes erreichbaren Energiekennwert bei einer Modernisierung
des jeweiligen Gebäudes. Diese liegen nun zwischen 25 und 35 kWh/(m²a)
und damit nochmals um mehr als einen Faktor zwei niedriger. Die
bei diesen Gebäuden durch eine umfassende Modernisierung mögliche
Energieeinsparung unter Einsatz von Passivhaus-Komponenten liegt
zwischen 80 und 90%.
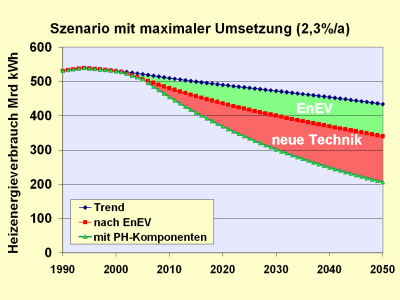
Wenn man weiterhin von hohen Umsetzungs- und Erneuerungsraten ausgeht,
nun aber den Heizenergieverbrauch des Jahres 2000 mit den Neuen
Bundesländer zurgrunde legt, so ergeben sich die in Abb3 aktualisierten
Szenarien.
Abb. 3 (Szenarien für ganz Deutschland (alte
und neue Bundesländer) unter der Annahme, dass die Umsetzung ab
2003 mit maximal möglicher Rate beginnt.)
Dem aus [Ebel 2000] übernommenen alten "Trend-Szenario"
sind nun die Auswirkungen der neuen Bestimmungen der EnEV von 2002
gegenüber zu stellen. Durch die höheren Anforderungen in Bezug auf
Fenster und Wärmedämmung sowie die Nachrüstpflichten prognostizieren
wir bereits eine spürbare Reduktion gegenüber dem alten Trend-Szenario.
Durch die Verfügbarkeit der Passivhaus-Komponenten ("neue Technik")
wird dieses Potential noch einmal mehr als verdoppelt. Diese Verdopplung
wird gebraucht, wenn katastrophale Folgen der Klimaerwärmung
wie das Abbrechen großer Inlandseisschollen in der Antarktis
vermieden werden sollen.
Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse der durchgeführten Demonstrationsvorhaben zeigen,
dass mit den heute verfügbaren Passivhaus-Komponenten auch im Gebäudebestand
durch Modernisierungsmaßnahmen Energiekennwerte um 25 kWh/(m²a)
erreichbar sind [AkkP 24]. Sollte bei den Außenwänden auf Grund
von Anforderungen des Denkmalschutzes oder bei Sichtfassaden keine
außenliegende Dämmung möglich sein, so sind mit einer Innendämmung
immer noch 50 bis 60 kWh/(m²a) erreichbar, diese Maßnahmen waren
Gegenstand der Arbeitskreissitzung
32 [AkkP 32]. Dabei gilt der Grundsatz, dass eine sorgfältig
geplante Innendämmung besser ist als keine Dämmung.
Die vorliegenden Potentiale lassen erkennen, dass durch ein engagiertes
Modernisierungsprogramm innerhalb einiger Jahrzehnte die Qualität
des Wohnungsbestandes ganz erheblich verbessert werden kann. Dabei
ist es möglich, den Heizenergieverbrauch in der Gesamtheit aller
Wohngebäude auf weniger als die Hälfte gegenüber heute zu senken
- dabei ist bereits berücksichtigt, dass es einen Sockelbestand
von Gebäuden gibt, die aus verschiedenen Gründen einer umfassenden
Modernisierung nicht zugänglich sind. Vor dem Hintergrund einer
erheblich verbesserten Effizienz können nun auch die Potentiale
der erneuerbaren Energiequellen (vgl. Abb. 1) neu bewertet
werden
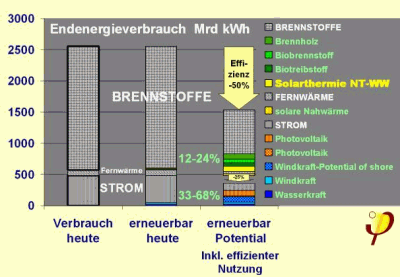
Durch den stark reduzierten Energiebedarf bei Einsatz effizienterer
Systeme können erneuerbare Energiequellen einen durchaus bedeutenden
Deckungsanteil erlangen. (Vgl. Abb. 4 (Potentiale
erneuerbarer Energiequellen auf dem Hintergrund einer deutlich verbesserten
Energienutzung)). Die Umsetzung dieser enormen Potential
erfolgt lokal und regional. Welche Instrumente sich dafür eignen,
welche Bespiele es bereits gibt und welche Erfahrungen damit gemacht
wurden - das wird Gegenstand der Diskussion in
Arbeitsgruppe 7:
Umsetzung und Finanzierung
Literatur:
[Arge 2001] Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen:
Auswertungstabellen zur Energiebilanz für die Bundesrepublik Deutschland
1990 bis 2000, Ausgabe 2001.
[Ebel 2000] Ebel, W.; Eicke-Hennig, W.; Feist, W.; Groscurth, Helmuth-Michael:
Energieeinsparung bei Alt- und Neubauten, 1. Auflage, Heidelberg,
2000.
[AkkP 24] Passivhauskomponenten
im Gebäudebestand , Protokollband Nr. 24 des Arbeitskreises
kostengünstige Passivhäuser Phase II, Passivhaus Institut
[AkkP 32] Passivhauskomponenten
und Innendämmung, Protokollband Nr. 32 des Arbeitskreises
kostengünstige Passivhäuser Phase II, Passivhaus Institut
(Autor des Textes: Dr. Wolfgang Feist; gekürzte und erweiterte
Fassung aus Protokollband 24 des Arbeitskreises kostenünstige
Passivhäuser)
Zeitplan 11. internationale Passivhaustagung
Bregenz
- 15.11.2006: Eingabeschluss für Abstracts
- bis 22.12.2006: Benachrichtigung der Autoren über Annahme
der eingereichten Abstracts
- 01.02.2007: Letzter Abgabetermin für angenommene schriftliche
Beiträge zum Tagungsband
- 13./14.04.2007: 11. Passivhaustagung Bregenz
- 15.04.2007 Exkursion zu gebauten Passivhäusern
Call
for Papers  PDF 259 kb
PDF 259 kb
Einladung
zur 11. Passivhaustagung 2007  PDF 259 kb
PDF 259 kb
Anreisebeschreibung
 PDF 63 kb
PDF 63 kb
|