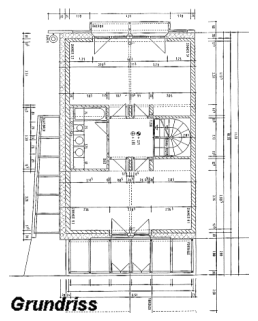| |
Energie
- Bezugs - Fläche |
|
Ist dieses Thema wichtig? - Eigentlich nicht besonders; es handelt sich
um eine reine Vereinbarungsfrage. Wichtig ist die substantielle Qualität
- wenn diese nun aber unter Bezug auf eine Referenzgröße,
nämlich die Energiebezugsfläche, bewertet wird (sprich: es
wird durch diese Fläche geteilt), dann sind Vergrößerungen
der Referenzgröße ein beliebtes Mittel zur Schönfärberei.
Und dann muss eben auch bei einem eigentlich unwichtigen Thema für
Transparenz gesorgt werden.
| Die Kernanforderung ist Transparenz: immer, wenn Kennwerte angegeben werden (gemessen in kWh/(m²a)), muss dabei stehen, auf welche Bezugsfläche sich diese Kennwerte beziehen. Allen anderen Zahlen sollten mit Vorsicht behandelt - und im Zweifel mit der Annahme der größtmöglichen Bezugsfläche bewertet werden. |
m² m²
m² m²
|
||||||||||||||||||
| Die Basis aller Angaben
ist eine Energiebilanz. Die Erstellung
der Energiebilanz ist von der (späteren) Wahl der Energiebezugsfläche
unabhängig. Das Ergebnis der Energiebilanz ist ein absoluter
Jahresenergiebedarf (rechnerisch) oder ein messtechnisch erfasster
absoluter Jahresenergieverbrauch. Beides angegeben in Energieeinheiten
pro Jahr (üblicherweise kWh/a). Wenn Zweifel an Kennwertangeben
vorliegen, ist es häufig am einfachsten, nach dem absoluten
Jahresenergiebedarf bzw. Jahresenergieverbrauch zu fragen. Her gibt
es zumindest bei der Bezugsgröße keine Konfusion. (Wohl
bei der Stufe im Energieversorgungssystem: ist es Nutzenergie (z.B.
Heizwärme) oder Endenergie (z.B. Strom) oder Primärenergie?
Auch das muss angegeben werden.) |
|||||||||||||||||||
Warum überhaupt Kennwerte? Wenn die Einführung von durch Bezugsflächen dividierten absoluten Verbräuchen Anlass zur Verwirrung stiften, warum führen wir diese dann überhaupt ein? Warum verwenden wir nicht einfach grundsätzlich die absoluten Jahresbedarfs- oder Verbrauchswerte? Ganz einfach: Gebäude sind sehr unterschiedlich groß. Vom kleinen freistehenden Einfamilienhaus bis zum Turm-Wohnpark mit 3000 Wohneinheiten. Absolute Verbrauchszahlen sagen daher nicht viel aus. Vielmehr muss der Verbrauch (Aufwand) in Relation zum Nutzen gesehen werden. Was aber ist der Nutzen? Das ist nicht von vorn herein evident - und deswegen gibt es dazu verschiedene Positionen. |
|||||||||||||||||||
| Welches ist die "richtige" Bezugsgröße? | |||||||||||||||||||
Andere (der VDI z.B.) ziehen das Brutto-Volumen V als Bezugsgröße vor (kWh/m³). Böse Zungen behaupten, dass dann der Heizwärmebedarf mit zunehmender Dämmdicke allein dadurch abnimmt, dass sich das Bezugsvolumen vergrößert. Das ist natürlich Unsinn - aber auch andere Totvolumina verbessern dann den Energiekennwert, wie z.B. die großen Lufträume in unserem Objektbeispiel im Norden des OG. Das führt zu Fehloptimierungen: Volumina werden größer gebaut, als wirklich nötig und bekommen dann dazu auch noch bessere Kennwerte. Das ist nicht zweckmäßig. Die "Nutz"fläche AN nach der deutschen Energieeinsparverordnung ist ein einfach nur auf eine Fläche linear umgerechnetes Bruttovolumen: AN= 0,32 m -1 V Diese "Fläche" kann man nirgendwo als Fläche messen - sie ist ein rein rechnerischer Wert - auch sie steigt mit dem Dämmvolumen und mit jeder Art von Totvolumen, ist somit genauso unzweckmäßig. Die Bruttogeschossfläche ABGF ist die Fläche des Rohbaus in Höhe der Geschosse. Sie ist sehr einfach zu ermitteln - enthält aber auch alle definitiv nicht nutzbaren Bereiche wie die Innen- und Außenwandquerschnitte, Erschließungsflächen usw. ABGF ist die größte unter den hier zur Diskussion stehenden Flächen. Sie wird gern in der Schweiz verwendet (z.B. durch MINERGIE®). Dadurch sehen die Schweizer Werte immer so gut aus! Die Wohnfläche AWF ist durch die tatsächlich betretbaren und mit Mobiliar bestellbaren Flächen, soweit es nicht Abstellflächen sind, definiert. Ein Nachteil ist, dass die Wohnfläche nicht weltweit einheitlich, sondern jeweils in nationalen Normen (und durchaus unterschiedlich) festgelegt wird. Diese Festlegung ist meist das Ergebnis von Verhandlungen der jeweiligen Vermieter- und Mieterverbände. Zur Wohnfläche gehören i.A. auch Außenflächen, die dann allerdings nur anteilig (z.B. ½) gerechnet werden - in unserem Beispiel sind es die Balkone und die Flächen im Nordglashaus. Die beheizte
Wohnfläche AbehWF ist durch die Wohnfläche,
sofern sie sich innerhalb der thermischen Hülle befindet.
Diese Fläche ist ein gutes Maß für den durch die
Heizung gelieferten "Nutzen". Der Nachteil, dass es
sich um nach nationalen Regelungen zu bestimmende Flächen
handelt, bleibt. |
|||||||||||||||||||
Um die Vorteile der Wohnfläche als Bezugsgröße zu behalten, sich aber von den nationalen Unterschieden zu befreien, wurde im Projket CEPHEUS die "treated floor area" TFA eingeführt. ATFA unterscheidet sich nur wenig von der beheizten Wohnfläche. (Zur Definition vgl. →TFA)
|
|||||||||||||||||||
| Wie wirkt sich das auf die Ergebnisse aus? | |||||||||||||||||||
Das ist ganz einfach - die substantiellen Ergebnisse ändern sich gar nicht - es wird immer gleich viel Energie verbraucht, welche Bezugsfläche auch immer gewählt wird. Rein subjektiv sehen die Ergebnisse natürlich besser aus, wenn die Bezugsfläche größer wird. Das sind im Beispiel bis zu 26%, es können sich in anderen Beispielen auch über 30% Unterschied ergeben. Unwichtig? - Im Grunde
ja, es sei denn... |
|
||||||||||||||||||
| ...die Anforderungen sind als Kennwert festgelegt. | |||||||||||||||||||
Deshalb ist es wichtig, alle flächenbezogenen Angaben auf die Flächen zu beziehen, die dem Anforderungswert zugrunde liegen. Beim Passivhaus ist diese Fläche die beheizte Wohnfläche - aus guten Gründen, denn ein Balkon ist für die Heizung ebenso wenig relevant wie eine Treppe oder ein Innenwandquerschnitt oder irgendein anderes nicht nutzbares Volumen. Es gehört mit zur Bauaufgabe, diese irrelevanten Flächen nicht ausufern zu lassen; auch dadurch wird das Bauen teurer und ineffizienter.
|
|||||||||||||||||||
| Eine
letzte Bemerkung Weder der Funktion noch dem Umweltschutz ist gedient, wenn Kennwerte einfach dadurch "verbessert" werden, dass die Bezugsfläche hochgesetzt wird. Das spart keine Energie - und es reduziert den CO2-Ausstoß nicht. |
|||||||||||||||||||
| PHPP Das Passivhaus Projektierungspaket ist ein Tool, mit dem ein Passivhaus ausgelegt und die Planung optimiert werden kann. Alle wichtigen Planungsdetails für ein Passivhaus werden unterstützt: Dämmung, Luftdichtheit, Wärmebrückenreduktion, Passivhausfenster, Lüftung, Heizlast, Wärmebereitstellung, Sommer-Behaglichkeit u.a. Das Handbuch zum PHPP enthält zudem praktische Tipps für die Planung und den Bau von Passivhäusern. Kernbestandteil des PHPP-Tools ist die Energiebilanz des Gebäudes. Näheres zum PHPP finden Sie unter PHPP-Beschreibung. |
| Dieser Link führt zu Basisinformationen zum Thema Passivhaus.
Berechnung der TFA (treated floor area) Die Berechnungsvorschrift wurde in einigen Punkten vereinfacht und an die Erfordernisse der Energiebilanzierung angepasst. Beheizte Nebenräume werden in diesem Verfahren berücksichtigt.
aktualisiert:
19.05.2007 |